1000
Type of resources
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale
-
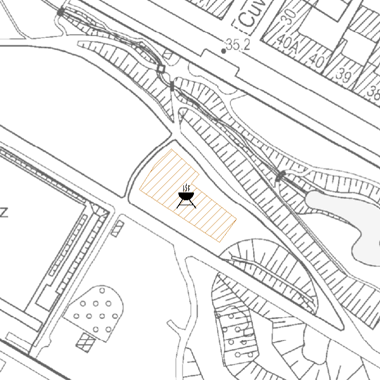
Der Datensatz beinhaltet Grillstandorte für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Reinickendorf und Tempelhof-Schöneberg. In öffentlichen Parks und Grünanlagen ist das Grillen grundsätzlich verboten, um Brände oder Belästigung der Anwohner zu vermeiden. Auf speziell dafür ausgeschilderten Plätzen ist jedoch auch in öffentlichen Park- und Erholungsanlagen das Grillen erlaubt. In den Bezirken Spandau und Steglitz-Zehlendorf gibt es keine ausgewiesenen Grillflächen. Bitte beachten Sie bei Trockenheit und Hitze ggf. von den örtlich zuständigen Bezirksämtern verhängte temporäre Grillverbote!
-
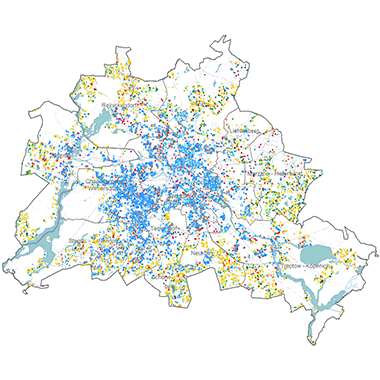
Darstellung aller in der Automatisierten Kaufpreissammlung registrierten und im Jahr 2017 abgeschlossenen Immobilienkauffälle; unterschieden in die Teilmärkte: unbebaute Grundstücke/bebaute Grundstücke/Wohnungs- und Teileigentum.
-
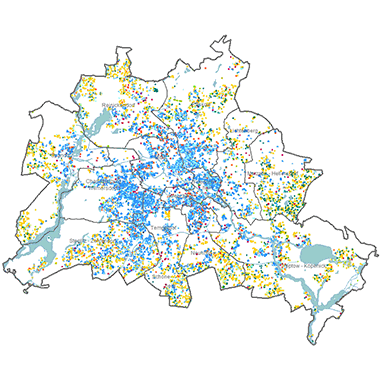
Darstellung aller in der Automatisierten Kaufpreissammlung registrierten und im Jahr 2020 abgeschlossenen Immobilienkauffälle; unterschieden in die Teilmärkte: unbebaute Grundstücke/bebaute Grundstücke/Wohnungs- und Teileigentum.
-
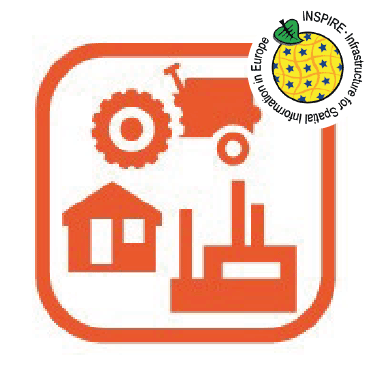
Dargestellt ist die tatsächliche Nutzung auf der Ebene der Grundrissdaten des Liegenschaftskatasters. Sie sind durch Attribute des INSPIRE-Datenmodells "Bodennutzung" beschrieben.
-
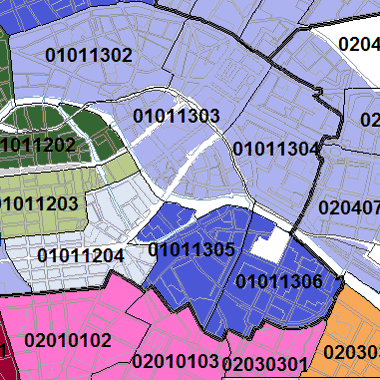
Die hier vorgelegte Fortschreibung des Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2009 wertet sozio-strukturelle Daten für den Beobachtungszeitraum 31.12.2007 bis 31.12.2008 erstmals ausschließlich auf Ebene der 447 Planungsräume (kleinräumigste Ebene der Lebensweltlich orientierten Räume / LOR) aus. Mit der Fortschreibung des Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2009 wird das statistische Verfahren der gestuften Index-Berechnung analog dem Monitoring 2008 und 2007 fortgeführt. Die 12 Indikatoren des Monitoring 2008 werden bis auf eine Ausnahme beibehalten: der Indikator Status 6 "Ausländeranteil unter 18 Jahren" wird ersetzt durch den "Anteil der Personen mit Migrationshintergrund unter 18 Jahren", da dieses Daten mittlerweile auch kleinräumig zur Verfügung stehen. Damit geht dieser neue Indikator im Unterschied zu den noch auf Verkehrszellenebene erstellten Monitoringberichten 2008 und 2007 in die Ergebnisberechnung der Indizes ein. Bei den Daten wird seit 2007 zwischen Indikatoren, die die soziale Lage in einem Quartier beschreiben ("Status") und Indikatoren, die den Wandel der Bevölkerung des Gebietes im abgelaufenen Jahr charakterisieren sollen ("Dynamik") unterschieden. Zu den Status-Indikatoren zählen Daten zur Arbeitslosigkeit, Transferbezug und zum Migrationshintergrund; zu den Dynamik-Indikatoren Daten zur Mobilität (selektive Wanderungen) und zu den Veränderungen einzelner Status-Indikatoren. Aus den sechs Status- und den sechs Dynamik-Indikatoren wird im gestuften Berechnungsverfahren zunächst jeweils ein Status- und ein Dynamik-Index gebildet. In einem nächsten Schritt wird aus Status- und Dynamik-Index in einem Verhältnis von 3:2 der Entwicklungsindex berechnet. Der Entwicklungsindex bildet die soziale Problematik im Gebiet als Wert ab: je höher der Wert, desto höher die soziale Problematik. Entsprechend der ermittelten Rangfolge der Gebiete werden Dezile (jeweils 10 Prozent) gebildet und zu vier Gruppen des Entwicklungsindex zusammengefasst: hoher (oberste 20 Prozent), mittlerer (60 Prozent), niedriger (vorletzte 10 Prozent) und sehr niedriger Entwicklungsindex (letzte 10 Prozent). In Gebieten mit einem sehr niedrigen Entwicklungsindex besteht nach diesen - quantitativen - Befunden stadtentwicklungspolitischer Interventionsbedarf, in Gebieten mit einem niedrigen Entwicklungsindex besteht Interventions- und Präventionsbedarf. Zur konkreten Festlegung von Maßnahmen in den einzelnen Gebieten sind in Ergänzung zur quantitativen Analyse vertiefende und insbesondere qualitative Betrachtungen erforderlich. Trotz der Umstellung der räumlichen Ebene von den 338 Verkehrszellen auf die 447 Planungsräume ähneln die Ergebnisse des Monitoring 2009 denen aus 2008: Beim Entwicklungsindex wird eine starke räumliche Konzentration der Planungsräume mit "sehr niedrigem Entwicklungsindex" erkennbar. Die westlichen Innenstadtgebiete stellen, wie in der Vergangenheit auch, die problematischsten Gebietstypen Berlins dar. Räumliche Konzentrationen liegen in Neukölln-Nord, Wedding, Moabit und Kreuzberg-Nord vor. Am Stadtrand haben sich in den Großsiedlungsgebieten negative Entwicklungstendenzen (Marzahn-Hellersdorf, Spandau) verstetigt und räumlich teilweise ausgeweitet. Diese, bereits im Monitoring 2008 benannten, fünf großen, zusammenhängenden Gebiete mit der höchsten Konzentration der problematischsten Gebiete bilden den Kern der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung abgegrenzten "Aktionsräume plus". Die östlichen Innenstadtgebiete hingegen haben sich weiter stabilisiert.
-
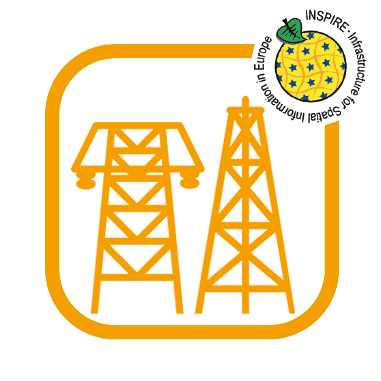
Dargestellt sind die öffentlichen und öffentlich geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE) im Land Berlin. Sie sind durch Attribute des INSPIRE-Datenmodells "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste" beschrieben.
-
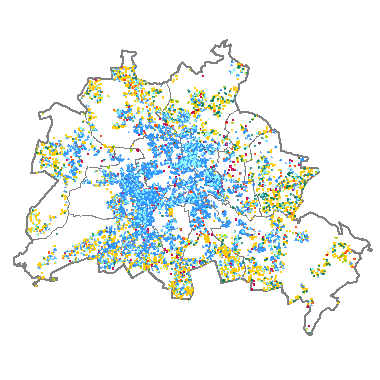
Darstellung aller in der Automatisierten Kaufpreissammlung registrierten und im Jahr 2021 abgeschlossenen Immobilienkauffälle; unterschieden in die Teilmärkte: unbebaute Grundstücke/bebaute Grundstücke/Wohnungs- und Teileigentum.
-
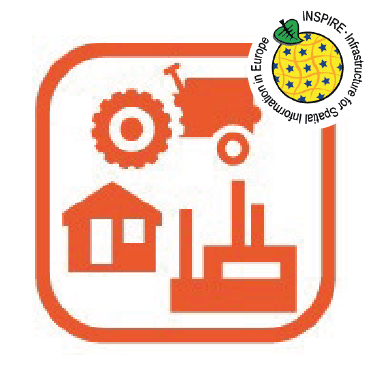
Dargestellt ist die zukünftig geplante Bodennutzung auf der sublokalen Ebene. Die Gebiete sind durch Attribute des INSPIRE-Datenmodells "Bodennutzung" beschrieben.
-
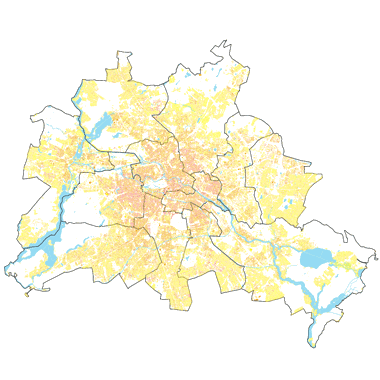
Der Datensatz stellt die Gebäudehöhen (Firsthöhen) auf der Grundlage der dreidimensionalen Gebäudemodelle des Landes Berlin im Level of Detail 2 (LoD2) dar. Die Grundrisse der Gebäude entsprechen genau den Gebäudeumringen, wie sie im Liegenschaftskataster ALKIS nachgewiesen sind. Für die Dachformen werden in den Attributen Angaben zur generalisierten Standarddachform angegeben. Die Daten werden computergestützt automatisiert berechnet. Für einzelne Gebäude konnte keine Höhe ermittelt werden.
-
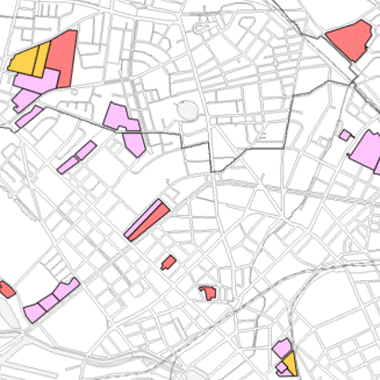
Alle geöffneten und geschlossenen Berliner Friedhöfe nach ihrem Träger einschließlich der drei großen sowjetischen Ehrenmale in Treptow, Schönholz und Tiergarten.
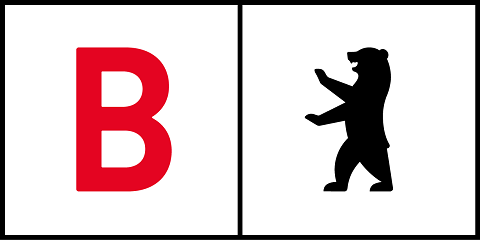 Geodatensuche Berlin
Geodatensuche Berlin