society
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
-
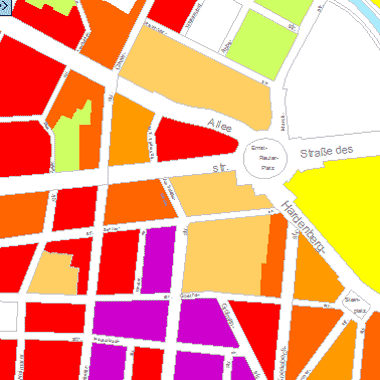
Einwohnerdichte in Einwohner/ha auf Grundlage der Blockkarte 1 : 50.000 (ISU50, Raumbezug Umweltatlas 1990), Erfassungsstand 31.12.2004.
-
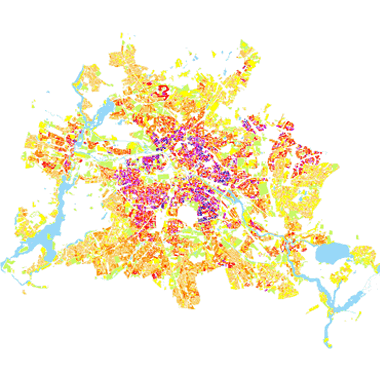
Einwohnerdichte in Einwohner/ha auf Grundlage der Blockkarte 1 : 5.000 (ISU5, Raumbezug Umweltatlas 2015), Erfassungsstand 31.12.2017.
-
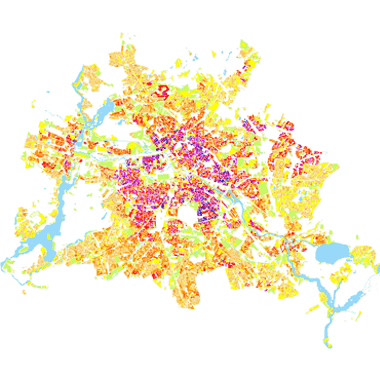
Einwohnerdichte in Einwohner/ha auf Grundlage der Blockkarte 1 : 5.000 (ISU5, Raumbezug Umweltatlas 2015), Erfassungsstand 31.12.2018.
-
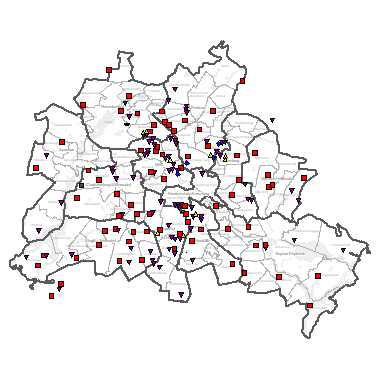
Darstellung aller Begräbnisplätze der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, die in der Zuständigkeit des Landes Berlin liegen, nach ihrem Träger.
-
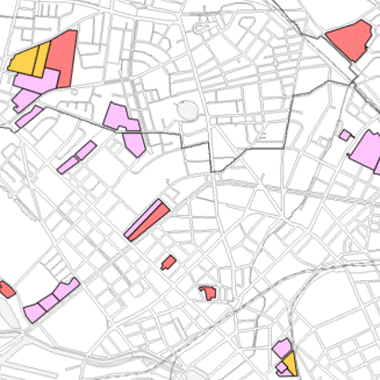
Alle geöffneten und geschlossenen Berliner Friedhöfe nach ihrem Träger einschließlich der drei großen sowjetischen Ehrenmale in Treptow, Schönholz und Tiergarten.
-
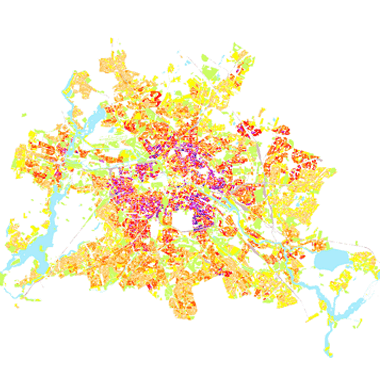
Einwohnerdichte in Einwohner/ha auf Grundlage der Blockkarte 1 : 5.000 (ISU5, Raumbezug Umweltatlas 2001), Erfassungsstand 31.12.2005.
-
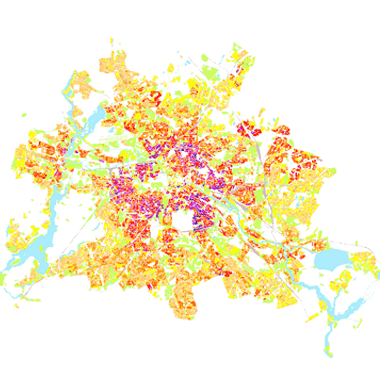
Einwohnerdichte in Einwohner/ha auf Grundlage der Blockkarte 1 : 5.000 (ISU5, Raumbezug Umweltatlas 2005), Erfassungsstand 31.12.2006.
-
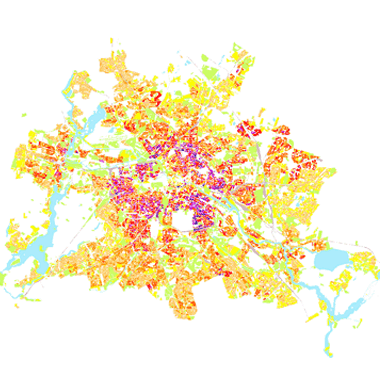
Einwohnerdichte in Einwohner/ha auf Grundlage der Blockkarte 1 : 5.000 (ISU5, Raumbezug Umweltatlas 2010), Erfassungsstand 31.12.2013.
-
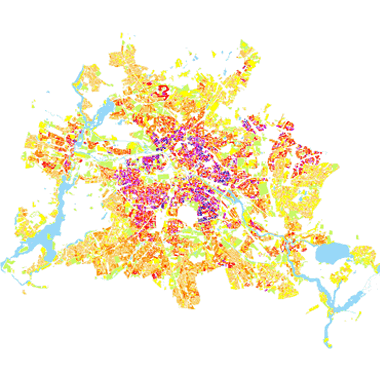
Einwohnerdichte in Einwohner/ha auf Grundlage der Blockkarte 1 : 5.000 (ISU5, Raumbezug Umweltatlas 2015), Erfassungsstand 31.12.2016.
-

Die hier vorgelegte Fortschreibung des Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010 wertet sozio-strukturelle Daten für den Beobachtungszeitraum 31.12.2008 bis 31.12.2009 auf Ebene der 447 Planungsräume (kleinräumigste Ebene der Lebensweltlich orientierten Räume / LOR) aus. Mit der Fortschreibung des Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010 wird das statistische Verfahren der gestuften Index-Berechnung fortgeführt. Die 12 Indikatoren des Monitoring 2009 werden beibehalten. Bei den Daten wird seit 2007 zwischen Indikatoren, die die soziale Lage in einem Quartier beschreiben ("Status") und Indikatoren, die den Wandel der Bevölkerung des Gebietes im abgelaufenen Jahr charakterisieren sollen ("Dynamik") unterschieden. Zu den Status-Indikatoren zählen Daten zur Arbeitslosigkeit, Transferbezug und zum Migrationshintergrund; zu den Dynamik-Indikatoren Daten zur Mobilität (selektive Wanderungen) und zu den Veränderungen einzelner Status-Indikatoren. Aus den sechs Status- und den sechs Dynamik-Indikatoren wird im gestuften Berechnungsverfahren zunächst jeweils ein Status- und ein Dynamik-Index gebildet. In einem nächsten Schritt wird aus Status- und Dynamik-Index in einem Verhältnis von 3:2 der Entwicklungsindex berechnet. Der Entwicklungsindex bildet die soziale Problematik im Gebiet als Wert ab: je höher der Wert, desto höher die soziale Problematik. Entsprechend der ermittelten Rangfolge der Gebiete werden Dezile (jeweils 10%) gebildet und zu vier Gruppen des Entwicklungsindex zusammengefasst: hoher (oberste 20%), mittlerer (60%), niedriger (vorletzte 10%) und sehr niedriger Entwicklungsindex (letzte 10%). In Gebieten mit einem sehr niedrigen Entwicklungsindex besteht nach diesen - quantitativen - Befunden stadtentwicklungspolitischer Interventionsbedarf, in Gebieten mit einem niedrigen Entwicklungsindex besteht Interventions- und Präventionsbedarf. Zur konkreten Festlegung von Maßnahmen in den einzelnen Gebieten sind in Ergänzung zur quantitativen Analyse vertiefende und insbesondere qualitative Betrachtungen erforderlich. Die Ergebnisse des Monitoring 2010 ähneln - hinsichtlich der Gruppenzugehörigkeit - denen des Monitoring 2009: Beim Entwicklungsindex wird eine starke räumliche Konzentration der Planungsräume mit "sehr niedrigem Entwicklungsindex" erkennbar. Die westlichen Innenstadtgebiete stellen, wie in der Vergangenheit auch, die problematischsten Gebietstypen Berlins dar. Räumliche Konzentrationen liegen in Neukölln-Nord, Wedding, Moabit und Kreuzberg-Nord vor. Am Stadtrand haben sich in einzelnen Großsiedlungsgebieten negative Entwicklungstendenzen (Marzahn-Hellersdorf, Spandau) verfestigt. Diese, bereits im Monitoring 2008 und 2009 benannten, fünf großen, zusammenhängenden Gebiete mit der höchsten Konzentration der problematischsten Gebiete bilden den Kern der vom Senat im Juni 2010 beschlossenen "Aktionsräume plus".
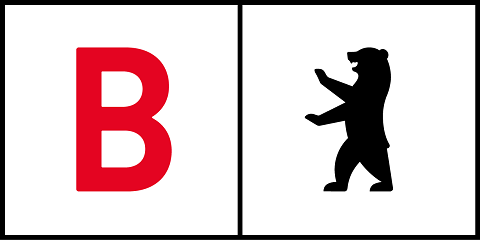 Geodatensuche Berlin
Geodatensuche Berlin